Die Nachricht von der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd im Iran hat in Deutschland und besonders im Norden tiefe Betroffenheit ausgelöst. In Niedersachsen, wo Sharmahd früher lebte, und auch in Hamburg reagieren Menschen, Politiker und Menschenrechtsorganisationen mit Empörung und Trauer. Der Fall hat eine Debatte über die Rolle der Bundesregierung im Umgang mit dem Iran entfacht und Forderungen nach schärferen Maßnahmen gegen das iranische Regime laut werden lassen.
Bundesregierung zeigt scharfe Reaktion
Nach Bekanntwerden der Hinrichtung bestellte das Auswärtige Amt am Dienstag den Leiter der iranischen Botschaft in Berlin ein, um gegen das Vorgehen zu protestieren. Außenministerin Annalena Baerbock zog außerdem den deutschen Botschafter aus Teheran zurück – ein Schritt, der das Unverständnis und die Verurteilung Deutschlands zum Ausdruck bringen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Hinrichtung als „Skandal“ und machte in einem Beitrag auf der Plattform X deutlich, dass die Tat gegen alle internationalen Standards der Menschenrechte verstoße.
Scharfe Kritik am Umgang der Bundesregierung
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen und weitere Menschenrechtsorganisationen äußerten jedoch Zweifel daran, dass die Bundesregierung genug unternommen habe, um Sharmahd zu schützen. Die Organisation kritisierte, dass die „stille Diplomatie“ der Bundesregierung offensichtlich nicht ausreichend war, um das Leben des Deutsch-Iraners zu retten. Die Tochter Sharmahds, die in den USA lebt, und zahlreiche Unterstützer werfen der deutschen Regierung vor, dass sie ihren Einfluss nicht genügend genutzt habe. Während andere europäische Staaten wie Frankreich in ähnlichen Fällen lauter protestierten und dadurch Erfolge erzielten, sei Deutschland in seiner öffentlichen Unterstützung zurückhaltender gewesen, so der Vorwurf.
Auch in Hamburgs Politik gab es kritische Stimmen. Die Vorsitzende der Grünen, selbst mit iranischen Wurzeln, stellte die Wirksamkeit der diplomatischen Maßnahmen in Frage und betonte, dass die Hinrichtung zeige, dass diese wohl nicht ausreichend waren, um das Leben Sharmahds zu schützen.
Forderungen nach schärferen Maßnahmen gegen den Iran
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert als Konsequenz härtere Sanktionen gegen das iranische Regime. Die Bundesregierung solle dem Beispiel Kanadas folgen und die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einstufen. Zudem schlug die Organisation vor, den wirtschaftlichen Austausch mit dem Iran drastisch zu reduzieren. „Die deutschen Geschäfte mit der iranischen Diktatur laufen besser denn je“, betonte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats und verwies darauf, dass das Handelsvolumen mit dem Iran im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf 636 Millionen Euro gestiegen sei.
Auch Amnesty International Deutschland forderte umfassende Maßnahmen. Die Organisation appellierte an die Bundesregierung, strafrechtliche Ermittlungen gegen die iranischen Verantwortlichen einzuleiten und Haftbefehle gegen jene zu erlassen, die an den Verbrechen gegen Sharmahd beteiligt waren. „Diese Personen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, so Amnesty in einer öffentlichen Stellungnahme.
Trauer und Proteste in Hamburg und Berlin
In Hamburg legten einige Trauernde am Montagabend Blumen vor dem iranischen Generalkonsulat nieder, um Sharmahds Tod zu gedenken. Auch in Berlin kam es am Dienstag vor der iranischen Botschaft zu einer Kundgebung, an der prominente Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, die Autorin Düzen Tekkal und die Produzentin Minu Barati-Fischer teilnahmen. Mit Plakaten und Fotos von Sharmahd drückten die Demonstranten ihre Solidarität mit dem Verstorbenen und seiner Familie aus. Auf Bannern waren Botschaften wie „We are Jimmy“ und „One for all, all for one“ zu lesen – ein eindringlicher Aufruf zur Unterstützung der iranischen Opposition.
Sharmahds Leben: Vom IT-Unternehmer zum Regimekritiker
Jamshid Sharmahd wurde 1955 im Iran geboren und zog im Alter von sieben Jahren mit seinem Vater nach Deutschland, wo er in Niedersachsen aufwuchs. Nach der islamischen Revolution 1979 verließ er den Iran erneut und baute sich in Deutschland eine Existenz auf. Später gründete er in Hannover ein Computergeschäft und engagierte sich immer stärker für die iranische Opposition. Im Jahr 2003 wanderte er in die USA aus, wo er ein Softwareunternehmen gründete und sich als Regimekritiker engagierte. Er gründete unter anderem einen Radiosender, über den er oppositionelle Botschaften verbreitete und sich gegen das iranische Regime stellte.
2020, während einer Geschäftsreise, wurde Sharmahd in Dubai offenbar vom iranischen Geheimdienst festgenommen und nach Teheran gebracht. Seitdem saß er in Isolationshaft und wurde 2023 in einem stark umstrittenen Prozess wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt.
Eine schwierige Balance zwischen Diplomatie und Härte
Die Hinrichtung von Jamshid Sharmahd zeigt die Herausforderung, vor der die deutsche Außenpolitik steht. Einerseits wird versucht, auf diplomatischem Weg Einfluss zu nehmen, andererseits wird zunehmend der Ruf nach schärferen Sanktionen laut. Sharmahds Fall zeigt, dass stille Diplomatie allein oftmals nicht ausreicht, um das Leben deutscher Staatsbürger in autoritären Staaten zu schützen.
Die Forderungen nach härteren Maßnahmen, wie die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation und der wirtschaftliche Boykott des Iran, gewinnen an Unterstützung – auch, weil der Fall Sharmahd einmal mehr die Menschenrechtsverletzungen des iranischen Regimes offenlegt.
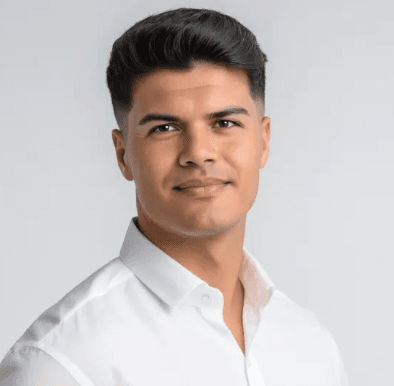
Mathias von Lichtenfeld hat ein Studium im Bereich Journalismus absolviert und arbeitet hauptberuflich in einer renommierten Medienagentur. Neben seiner beruflichen Tätigkeit verfasst er regelmäßig Artikel für das Steindamm Magazin, in denen er über lokale Themen berichtet und seine journalistische Expertise einbringt.










