Hamburg St. Georg, ein Stadtteil, der ohnehin schon mit sozialen Spannungen, Drogenproblemen und Kriminalität zu kämpfen hat, steht nun vor einem neuen, alarmierenden Phänomen: Eine bislang unbekannte Gruppierung scheint Crack-Süchtige gezielt mit akustischen Geräuschmanipulationen zu belästigen und zu vertreiben. Recherchen und Berichte aus der Szene legen nahe, dass diese Methoden nicht nur illegal, sondern auch gesundheitlich bedenklich sind – für die Betroffenen ebenso wie für die Anwohner.
Ein neuer Konflikt im Stadtteil
Der Hansaplatz und der Steindamm sind seit Jahren zentrale Schauplätze für Drogenhandel und -konsum. Besonders Crack, eine hochpotente Form von Kokain, wird hier häufig konsumiert. Die Polizei ist mit der Situation vertraut und hat bereits verstärkte Präsenz gezeigt, doch die Probleme sind hartnäckig. Nun kommt ein neues Element ins Spiel: Eine Gruppierung, die offenbar versucht, Crack-Süchtige aus dem Viertel zu vertreiben, und dabei auf fragwürdige und rechtswidrige Methoden zurückgreift.
Zahlreiche Abhängige und auch Anwohner haben in den letzten Wochen berichtet, dass sie von akustischen Geräuschen in bestimmten Straßen und Ecken belästigt werden. Diese Geräusche, die oft nur von den Betroffenen selbst wahrgenommen werden, reichen von hohen Frequenzen bis hin zu unerträglichen Störgeräuschen. Die Auswirkungen sind dabei klar: Die Geräusche sollen die Süchtigen vertreiben, indem sie den Aufenthalt im Freien, besonders in den bekannten Drogen-Hotspots, unerträglich machen.
Illegale Akustikmanipulation: Ein perfides Instrument
Nach ersten Recherchen handelt es sich bei dieser akustischen Manipulation um gezielte Maßnahmen, um bestimmte Personengruppen zu vertreiben. Experten, die sich mit sogenannter „akustischer Kriegsführung“ auskennen, haben bestätigt, dass spezielle Hochfrequenztöne – die in Frequenzbereichen ausgesendet werden, die für die meisten Menschen kaum wahrnehmbar sind – genutzt werden, um psychischen und physischen Stress zu verursachen. Solche Methoden sind unter normalen Umständen nicht hörbar, doch in hoher Intensität können sie Kopfschmerzen, Übelkeit und Unwohlsein auslösen.
Diese „Sound-Attacken“ sind in Deutschland illegal und verstoßen gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und den Schutz der Menschenwürde. Doch die Täter agieren verdeckt: Die Quelle der Töne ist bislang nicht eindeutig zu lokalisieren, doch es wird vermutet, dass mobile Lautsprecher oder versteckte Geräte in unauffälligen Bereichen platziert werden, um gezielt die Drogenszene zu stören.
Wer steckt dahinter?
Die große Frage, die sich stellt, ist: Wer steckt hinter dieser Aktion? Bisher gibt es nur Vermutungen, doch es wird angenommen, dass es sich um eine Art „Bürgerwehr“ oder selbsternannte Sicherheitsgruppe handeln könnte, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Viertel zu „säubern“. Solche Gruppierungen operieren meist im Verborgenen und sehen sich als Alternative zur offiziellen Polizei, oft mit einer rigorosen und rechtswidrigen Vorstellung von Ordnung und Sauberkeit.
Anwohner berichten von einer zunehmenden Frustration über die Drogenproblematik in St. Georg, was durchaus ein Nährboden für solche radikalen Maßnahmen sein könnte. „Es ist unerträglich geworden“, sagt ein Geschäftsmann vom Steindamm, der anonym bleiben möchte. „Aber so etwas kann keine Lösung sein. Die Menschen, die hier leben, brauchen Hilfe, nicht Verfolgung.“
Die Auswirkungen auf die Betroffenen
Für die Crack-Süchtigen ist diese Art der Belästigung besonders gravierend. Viele von ihnen leiden bereits unter gesundheitlichen Problemen, die durch ihren Drogenkonsum verursacht werden. Die ständige Konfrontation mit Störgeräuschen verstärkt ihre ohnehin angespannte psychische und körperliche Verfassung. „Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren, wenn ich am Hansaplatz stehe“, berichtet ein Betroffener, der regelmäßig in St. Georg Crack konsumiert.
Der gesundheitliche Schaden solcher akustischen Attacken ist nicht zu unterschätzen. Experten warnen vor langfristigen Schäden, die durch ständige Beschallung mit extremen Frequenzen entstehen können. Besonders gefährdet sind Menschen, die ohnehin schon geschwächt sind, wie eben viele Crack-Süchtige. Doch auch Unbeteiligte, wie Passanten oder Anwohner, können von diesen Geräuschen betroffen sein, was die Gefährdung durch diese illegalen Maßnahmen noch verstärkt.
Rechtliche Konsequenzen und Ermittlungen
Die Polizei hat bereits erste Hinweise erhalten und Ermittlungen aufgenommen. Bisher gibt es jedoch keine konkreten Beweise, wer hinter den Geräuschmanipulationen steckt. „Wir nehmen diese Vorfälle sehr ernst“, erklärte ein Sprecher der Polizei Hamburg. „Solche Maßnahmen sind illegal und gefährlich. Jeder, der versucht, eigenständig Ordnung zu schaffen und dabei gegen das Gesetz verstößt, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.“
Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Aktivitäten oder Geräusche zu melden, damit die Täter ermittelt werden können. Inzwischen werden auch technische Maßnahmen geprüft, um die Quellen der akustischen Belästigung zu lokalisieren und zu stoppen.
Die sozialen Dimensionen: Kriminalität versus Menschlichkeit
Der Einsatz von akustischen Belästigungsmethoden wirft auch die Frage auf, wie mit der Drogenproblematik in St. Georg umgegangen werden sollte. Während viele Anwohner frustriert über die anhaltende Kriminalität sind und sich nach Lösungen sehnen, zeigen solche illegalen Aktionen deutlich, dass die Vertreibung der Betroffenen keine nachhaltige Lösung sein kann. Die Crack-Süchtigen von St. Georg sind oft Opfer einer vielschichtigen sozialen Misere – Armut, Obdachlosigkeit, psychische Erkrankungen und Abhängigkeit. Akustische Angriffe, die darauf abzielen, diese Menschen zu vertreiben, verschlimmern lediglich ihre ohnehin prekäre Lage.
Soziale Einrichtungen und Drogenhilfezentren haben sich wiederholt dafür ausgesprochen, die Situation durch Präventionsarbeit, Beratung und Substitutionsprogramme zu verbessern, anstatt durch aggressive oder radikale Methoden vorzugehen. Der Hansaplatz und der Steindamm sind seit Jahrzehnten Hotspots für Drogenkriminalität, doch Experten betonen, dass eine Lösung nur durch Kooperation zwischen der Stadt, der Polizei und den Hilfsorganisationen möglich ist.
Ein gefährlicher Trend
Die gezielte Belästigung von Crack-Süchtigen in St. Georg durch akustische Geräuschmanipulation ist ein besorgniserregender Trend, der auf den ersten Blick als „Bürgerwehren“-Akt erscheinen mag, aber schwerwiegende rechtliche und ethische Fragen aufwirft. Der Versuch, die Drogenszene mit illegalen Mitteln zu bekämpfen, schadet nicht nur den Betroffenen, sondern auch dem sozialen Gefüge des Viertels.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, doch es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen für diese inakzeptablen Maßnahmen zur Rechenschaft gezogen werden können. St. Georg braucht eine nachhaltige Lösung für seine sozialen Probleme – nicht mehr Konflikte.
Akustische Manipulation: Wie Geräusche Crack-Süchtige beeinflussen können
In vielen Städten, darunter auch Hamburg, suchen manche Gruppen oder Einzelpersonen nach ungewöhnlichen Methoden, um Drogenabhängige von öffentlichen Plätzen zu vertreiben. Eine dieser Methoden ist die sogenannte Geräuschmanipulation, bei der akustische Signale eingesetzt werden, um Drogenabhängige – insbesondere Crack-Süchtige – zu stören und zu vertreiben. Doch was steckt hinter dieser Methode, warum wirkt sie besonders auf Crack-Süchtige, und welche Geräte kommen dabei zum Einsatz?
Crack und die erhöhte Sensibilität für Reize
Um zu verstehen, warum akustische Manipulation besonders auf Crack-Süchtige wirkt, ist es wichtig, die Auswirkungen von Crack auf den Körper und das Gehirn zu betrachten. Crack ist eine besonders schnelle und starke Form von Kokain, die in gerauchtem Zustand konsumiert wird. Es erzeugt einen intensiven, aber kurzen Rausch, der das Belohnungssystem des Gehirns extrem stimuliert. Dabei kommt es zu einem schnellen Anstieg von Dopamin im Gehirn, was einen euphorischen Effekt erzeugt. Gleichzeitig führt Crack zu einer verstärkten Sensibilität gegenüber äußeren Reizen, insbesondere Licht und Geräuschen.
Während des Rausches und besonders während der Phasen des Entzugs oder der Reizüberflutung nach dem Konsum sind Crack-Süchtige oft stark auf Sinneseindrücke fixiert. Sie erleben verstärkte Reaktionen auf Licht, Geräusche und andere sensorische Reize. Dies macht sie besonders anfällig für akustische Manipulationen, da ihr Gehirn Geräusche intensiver und teilweise verzerrt wahrnimmt. Geräusche, die für normale Menschen kaum wahrnehmbar oder lediglich störend sind, können bei Crack-Süchtigen zu starker Reizüberflutung, Stress oder sogar Panik führen.
Geräuschmanipulation als Belästigungsstrategie
Die Manipulation durch Geräusche setzt genau an dieser erhöhten Sensibilität an. Das Ziel ist, durch bestimmte akustische Signale eine unangenehme und schwer erträgliche Umgebung zu schaffen, in der sich die Süchtigen nicht länger aufhalten wollen. Diese Methode wird zunehmend von Menschen eingesetzt, die versuchen, Drogenabhängige von bestimmten Orten, wie Bahnhöfen, Parks oder öffentlichen Plätzen, zu vertreiben. Oft geschieht dies auf illegale Weise und ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen.
Die Art der eingesetzten Geräusche variiert, doch häufig werden folgende Methoden verwendet:
• Hochfrequenzgeräusche: Hohe Frequenzen, auch als „Mosquito“-Töne bekannt, werden oft eingesetzt, um gezielt bestimmte Altersgruppen oder Personengruppen zu stören. Diese Töne sind für jüngere Menschen oder Menschen mit empfindlichem Gehör besonders unangenehm. Für Crack-Süchtige, die ohnehin eine erhöhte Sensibilität für Reize haben, können solche Töne extrem belastend wirken.
• Störgeräusche: Tiefe Brummtöne, schrilles Pfeifen oder wiederkehrende, monotone Geräusche können ebenfalls gezielt eingesetzt werden, um eine unerträgliche Atmosphäre zu schaffen. Diese Geräusche führen bei den Betroffenen häufig zu Stress, Konzentrationsstörungen und einer Verstärkung des ohnehin bestehenden psychischen Drucks.
• Unregelmäßige Tonfolgen: Geräusche, die in unregelmäßigen Abständen abgespielt werden, können besonders störend wirken, da sie das Gehirn dazu zwingen, sich ständig auf neue, unvorhersehbare Reize einzustellen. Dies verstärkt die Anspannung und das Unbehagen bei den Betroffenen.
Geräte zur akustischen Belästigung
Die Technologie, die zur Geräuschmanipulation eingesetzt wird, ist in der Regel leicht zugänglich und kann oft unauffällig platziert werden. Zu den häufig verwendeten Geräten gehören:
• Hochfrequenzlautsprecher: Diese Lautsprecher sind in der Lage, Töne im hohen Frequenzbereich abzugeben, die für die meisten Menschen kaum hörbar sind, aber auf jüngere Personen oder Drogenabhängige mit empfindlichem Gehör eine starke Wirkung haben. Solche Geräte wurden ursprünglich entwickelt, um Jugendliche von bestimmten Plätzen fernzuhalten, werden jedoch zunehmend auch gegen Drogenkonsumenten eingesetzt.
• Tragbare Sound-Emitter: Diese Geräte sind klein und tragbar, sodass sie an verschiedenen Orten unauffällig aufgestellt oder versteckt werden können. Sie geben kontinuierlich störende Geräusche ab, die in einem bestimmten Radius wirken. Der Vorteil dieser Geräte liegt darin, dass sie flexibel einsetzbar sind und von den Betroffenen oft nicht sofort als Quelle des Lärms erkannt werden.
• Ultraschallgeräte: Ultraschall wird ebenfalls verwendet, um eine unangenehme Umgebung zu schaffen. Diese Geräte senden Schallwellen im Bereich des Ultraschalls aus, die für das menschliche Gehör normalerweise nicht wahrnehmbar sind, aber unter bestimmten Bedingungen Unwohlsein, Kopfschmerzen oder sogar Übelkeit hervorrufen können. Für Menschen, die auf solche Reize besonders sensibel reagieren, kann dies zu massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
Die Wirkung auf Crack-Süchtige
Die Auswirkungen dieser Geräuschmanipulation auf Crack-Süchtige sind tiefgreifend. Aufgrund ihrer erhöhten Sensibilität reagieren sie besonders stark auf akustische Reize, was die Störgeräusche für sie zu einem unerträglichen psychischen und physischen Stressfaktor macht. Typische Reaktionen sind:
• Angst und Panik: Die unvorhersehbaren und intensiven Geräusche verstärken das Gefühl von Unsicherheit und Paranoia, das viele Süchtige ohnehin bereits durch den Drogenkonsum erleben. In extremen Fällen können die akustischen Reize Panikattacken auslösen.
• Konzentrationsstörungen und Verwirrung: Die konstante Beschallung durch unangenehme Geräusche beeinträchtigt die kognitive Funktion der Betroffenen. Viele Crack-Süchtige berichten, dass sie unter akustischen Manipulationen Schwierigkeiten haben, klar zu denken oder einfache Entscheidungen zu treffen.
• Physische Symptome: Neben den psychischen Auswirkungen können die Geräusche auch körperliche Beschwerden hervorrufen, darunter Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Schlafstörungen. Da viele Drogenabhängige ohnehin bereits gesundheitlich stark angeschlagen sind, verschlimmern diese Effekte ihre Lage zusätzlich.
Die rechtliche und ethische Dimension
Die gezielte Belästigung von Crack-Süchtigen durch Geräuschmanipulation ist in Deutschland nicht nur unethisch, sondern auch illegal. Solche Maßnahmen verstoßen gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und können als Nötigung oder Körperverletzung geahndet werden. Zudem ist der Einsatz von Geräten, die Menschen gezielt belästigen oder schädigen sollen, in öffentlichen Räumen rechtlich nicht zulässig.
Auch aus ethischer Sicht ist der Einsatz solcher Methoden fragwürdig. Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit, die medizinische und soziale Unterstützung erfordert – keine Form von Belästigung oder Vertreibung. Die gezielte Störung von Suchtkranken, die ohnehin in einer prekären Situation leben, verschärft nur die ohnehin bestehenden Probleme, ohne eine nachhaltige Lösung zu bieten.
Eine gefährliche Praxis mit schwerwiegenden Folgen
Geräuschmanipulation ist eine gefährliche und illegale Methode, die gezielt eingesetzt wird, um Crack-Süchtige und andere Drogenabhängige zu belästigen und von öffentlichen Plätzen zu vertreiben. Für die Betroffenen kann diese Form der Manipulation zu schwerwiegenden psychischen und physischen Problemen führen und verschärft ihre ohnehin schon prekären Lebensumstände. Statt auf solche fragwürdigen Maßnahmen zu setzen, sollten Städte und Gemeinden in Prävention, Therapie und soziale Unterstützung investieren, um das Drogenproblem nachhaltig zu bekämpfen.
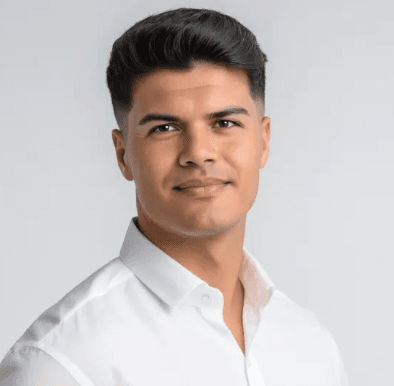
Mathias von Lichtenfeld hat ein Studium im Bereich Journalismus absolviert und arbeitet hauptberuflich in einer renommierten Medienagentur. Neben seiner beruflichen Tätigkeit verfasst er regelmäßig Artikel für das Steindamm Magazin, in denen er über lokale Themen berichtet und seine journalistische Expertise einbringt.










